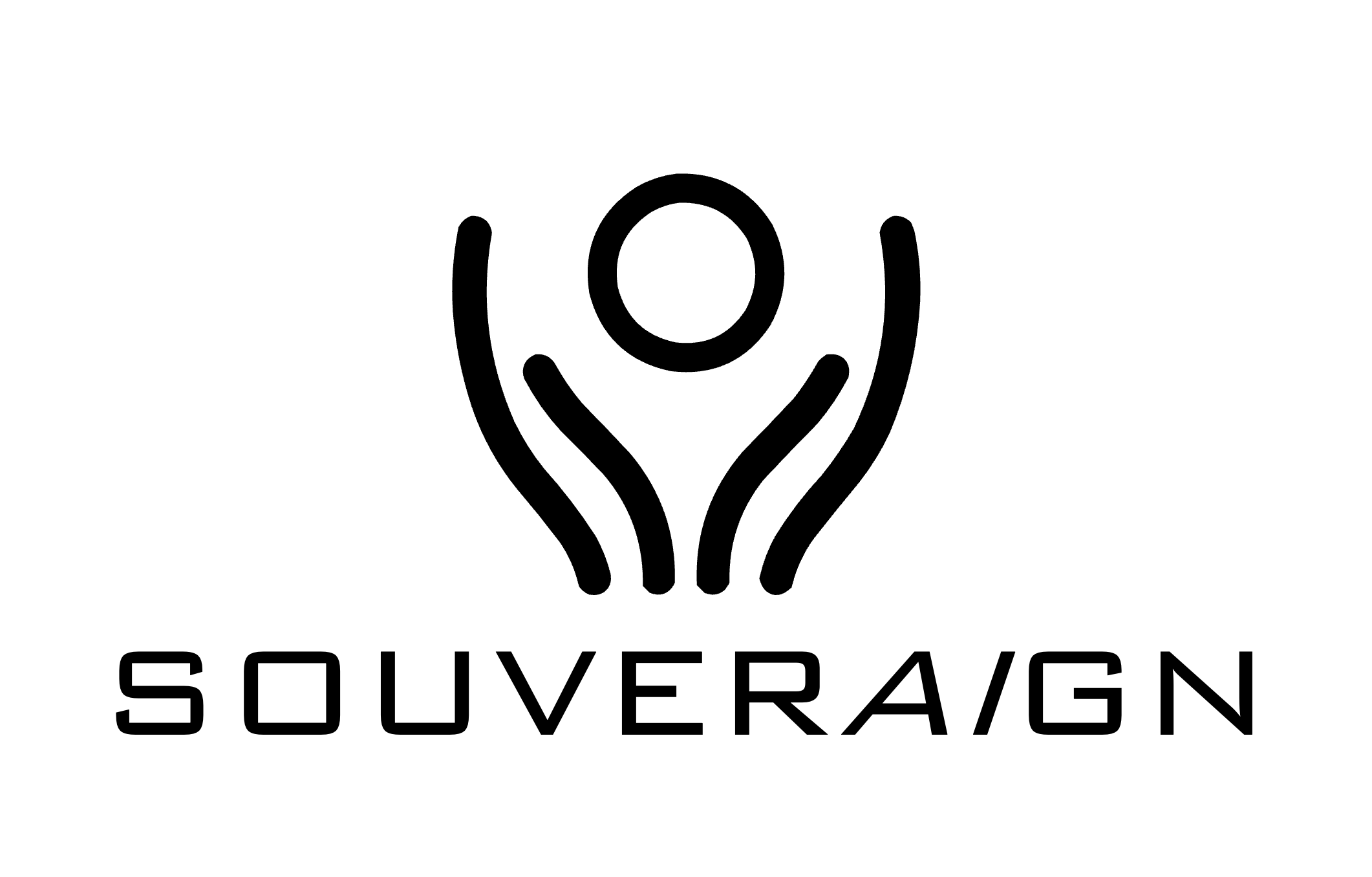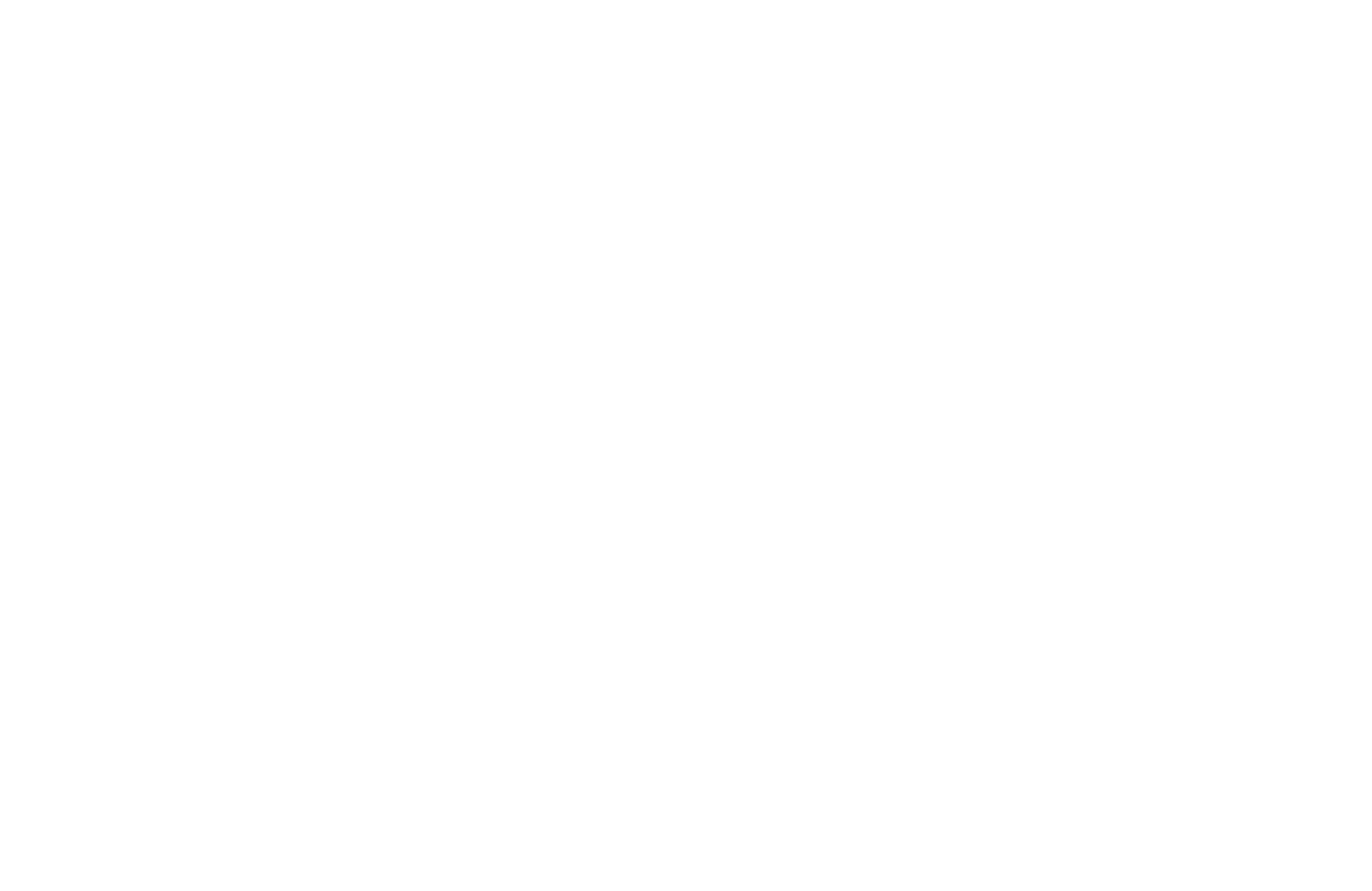Der Lock-in beginnt mit günstigen Einstiegspreisen
Viele Anbieter setzen auf ein bekanntes Prinzip: Niedrige Einstiegshürden in Kombination mit funktionalen Limits, die skalieren.
Beispielhafte Mechanismen:
- Freemium-Modelle: Gratisnutzung mit eingeschränkten Funktionen
- Nutzerbasierte Preisstaffelung: Je mehr Teammitglieder, desto teurer
- Storage- oder API-Limits: Bei wachsendem Datenaufkommen explodieren die Kosten
- Unterschiedliche Preisdimensionen: Kombination aus Basisgebühr, Add-ons, Support-Levels, Transaktionskosten
Was harmlos beginnt, wird im Alltagsbetrieb schnell komplex und intransparent – vor allem, wenn mehrere Produkte desselben Anbieters im Einsatz sind (z. B. Microsoft, Google, Salesforce).
Die Kosten steigen – schleichend, aber sicher
Typische Beobachtungen in Unternehmen:
- Jährliche Preissteigerungen um 10–25 %, oft ohne Mehrwert
- Einführung neuer Lizenzmodelle, die bestehende Verträge entwerten
- Reduktion von Inklusiv-Leistungen, z. B. API-Zugriffe oder Speicherplatz
- Versteckte Kosten durch Zusatzfunktionen, Integrationstools, Compliance-Pakete
- Kosten durch Nichtnutzung: Accounts, die nicht gelöscht werden, aber weiter zahlen
Ein zentrales Problem: Viele dieser Entwicklungen sind vertraglich zulässig, da AGB-Anpassungen durch Anbieter vorbehalten sind – oft ohne explizite Zustimmung des Kunden.
Der Wechsel wird mit jedem Monat schwieriger
Ein Systemwechsel ist in der Theorie möglich – inder Praxis aber oft aufwändig, teuer oder gar nicht realistisch. Denn:
- Daten liegen in proprietären Formaten vor (z. B. CRM, Analytics, Projekttools)
- Schnittstellen sind nicht dokumentiert oder exportfähig
- Nutzer:innen sind geschult und gewöhnt – Schulungskosten für Alternativen sind hoch
- Integrierte Workflows müssten neu aufgebaut werden
- Verträge sind gebündelt (z. B. Microsoft E5, Google Workspace mit Add-ons)
Der sogenannte Vendor Lock-in entsteht nicht nurtechnisch – er ist organisatorisch und kulturell verankert. Und genau diese Lock-ins nutzen Anbieter, umPreise anzuheben, ohne Wechselrisiken einzugehen.
Typische Preisentwicklungsstrategien
Fallbeispiel: Collaboration-Suite als Kostenfalle
Ein Mittelständler entscheidet sich für eine umfassende SaaS-Collaboration-Suite mit Dokumenten, Kommunikation, Kalender, KI-Funktionen. Die Einstiegskosten liegen bei unter 10 €/User/Monat.
Zwei Jahre später:
- Die Preise steigen auf 15 €/User
- Neue Funktionen sind nur im Enterprise-Paket enthalten (30 €/User)
- Zusätzliche API-Zugriffe müssen einzeln bezahlt werden
- Die Alternative eines Wechsels ist unattraktiv, weil alle Prozesse auf dem System basieren
Ergebnis: Die Gesamtkosten haben sich verdreifacht – ohne relevante Verbesserung des Nutzens.
Was tun? Kostenkontrolle durch Architektur
Preis-Transparenz einfordern
- Anbieter mit offenen Preislisten und klarer Staffelung bevorzugen
- Kein Anbieterwechsel ohne Simulation des 24-Monats-Kostenverlaufs
Modulare Architektur aufbauen
- Vermeidung von „Suiten“ zugunsten einzelner, austauschbarer Tools
- APIs prüfen: Können Daten und Funktionen auch mit anderen Tools genutzt werden?
Open-Source prüfen
- Offene Software ist nicht gratis – aber kontrollierbar
- Die Kosten sind transparent und nicht von fremden Roadmaps abhängig
Exit-Strategiedokumentieren
- Technisch: Datenformate, Exporte, Schnittstellen
- Organisatorisch: Schulungsaufwand, Prozessportierung
Fazit: Wer keine Kostenkontrolle hat, zahlt mit Abhängigkeit
Kostenentwicklung ist kein Betriebsproblem – sie ist strategisch.
Undurchsichtige Preismodelle, wachsender Lock-in und begrenzte Alternativen machen viele Anbieter unangreifbar – zu Lasten der Unternehmen.
Die Lösung liegt in bewusstem Technikeinsatz, modularen Architekturen und Exit-Optionen.
Wer heute auf Kontrolle achtet, vermeidet die Preiserhöhung von morgen – oder kann ihr zumindest selbstbewusst entgegentreten.